20.11.2014 “Qualität 2030 - die umfassende Strategie für das
Gesundheitswesen” - Fortsetzung 5 -
Schwerpunkt: Pay for Performance (P4P) (s. auch hier)
Was kommt als nächstes? Die internationale Entwicklung spricht klar für die baldige
Einführung einer Qualitäts-orientierten Vergütung (P4P). Als Vorbilder sind in erster
Linie das Value-Based Performance Programm in den USA, das alle
Krankenhäuser umfasst und ab 2015 auch den ambulanten Bereich betrifft, und das
von NICE kontinuierlich weiter ausgebaute Quality and Outcome Framework in
Großbritannien zu nennen. Auch der Koalitionsvertrag der Großen Koalition vom
November 2013 äußert sich in diesem Sinne. Nur - man sollte sich vor einem allzu eiligen Automatismus hüten, denn wenn
dieser nächste Schritt scheitert, dürfte der Qualitätsgedanke erheblichen Schaden nehmen.
Am Anfang steht also, wie vorstehend geschildert, eine gründliche Bedarfs- bzw Problemanalyse und die Entwicklung eines
adäquaten Rahmenkonzeptes. Beide bilden den Hintergrund, vor dem die Diskussion um Pay for
Performance nun auch in Deutschland geführt werden kann, nicht als Selbstzweck, sondern zur
Lösung der zukünftigen, im vorliegenden Gutachten als „fünf Ziele“ bezeichneten
Versorgungsprobleme. P4P ist ein komplexes Feedback-Verfahren, das Wettbewerbselemente
einsetzt, um Qualitätsdefizite in Gesundheitsversorgung und Prävention günstig zu beeinflussen. Es ist
aus zwei Systematiken zusammengesetzt und basiert auf (1) einer Qualitätsmessung durch definierte
Indikatoren und (2) einer nachvollziehbaren Kopplung der Qualität oder Effizienz (value) der
Versorgung an Vergütungsbestandteile. P4P wird in der Regel nicht als einziges, alleinstehendes
Vergütungssystem verwendet, sondern in andere Vergütungssysteme (z.B. DRG-System) integriert. Es
gehört zu den Instrumenten des sog. Qualitätswettbewerbes und setzt direkte finanzielle Anreize ein,
während public reporting (Qualitätssicherung nach §137 SGB V) seine Wirkung über indirekte
finanzielle Anreize (Marktvorteil wegen besserer Qualität) erzielt.
Die frühen Erfahrungen mit P4P waren sehr ermutigend, die ersten Studien und Reviews kamen zu besseren Ergebnissen
als die späteren Evaluationen. Der Sachverständigenrat sprach sich daher
auf der Basis seines frühen Systematischen Reviews (Studien bis 2006) zur
kurzfristigen Wirksamkeit von P4P auf definierte Versorgungsziele vorsichtig
für einen Einsatz von P4P aus. Die langfristigen Ergebnisse ergaben
jedoch sowohl für den stationären (z.B. Premier Hospital Quality Incentive
Demonstration Project (HQIP) in den USA) als auch für den ambulanten
Bereich (Quality and Outcome Framework (QOF) in Großbritannien) nur
einen mäßigen Erfolg. Zwar konnten die Verbesserungen durch P4P zeitlich
vorgezogen werden, die Varianz der Indikatoren wurde reduziert und die
Team-Arbeit oder eine Veränderung der beruflichen Rollen gefördert, aber
die Verbesserungen waren zeitlich begrenzt, es zeigten sich keine
Verbesserungen in nicht angereizten Leistungsbereichen (kein spill over),
und die erhoffte Förderung gerade der poor performers blieb aus.
So mutet es auf den ersten Blick paradox an, dass trotz der relativ
enttäuschenden Langfristergebnisse sowohl in den USA als auch in Großbritannien am Gedanken einer Qualitäts-orientierten
Vergütung nicht nur festgehalten wurde, sondern dass man diese sogar deutlich ausgebaute und erweiterte. Hier kommt
das conceptual framework zum Tragen, so wie es in den USA (Crossing the Quality Chasm des IOM (2001)) und in
Großbritannien (The NHS Outcome Framework 2013/2014 des NHS) vorlag bzw. vorliegt: die Indikatoren waren bereits
langfristig bekannt, es kam zu einem ceiling-Effekt, die poor performer wurden wegen einer mangelhaften Kopplung der
finanziellen Anreize an die Qualität nicht motiviert, durch den gleichzeitigen Einsatz von Public Reporting und P4P
neutralisierten sich diese Instrumente (dual use), die Vergütung war zu niedrig (vor allem unter Berücksichtigung der
Opportunitäts- und Grenzkosten) und man hatte die Risiko-Aversion der Entscheidungsträger sowie die Dominanz des
grundlegenden Vergütungssystems (DRG) unterschätzt.
So ist auch in Deutschland davon auszugehen, dass P4P ohne ein Rahmenkonzept, so wie es oben in Ansätzen
ausgeführt wurde, weder sinnvoll einzuführen noch zu evaluieren ist, weil keine realistischen Grundannahmen,
Rahmenbedingungen und Erwartungen formuliert werden können. Das vorliegende Gutachten hat ein solches Konzept
entwickelt – zunächst auf den ersten Blick resultieren daraus die Notwendigkeit der vorgeschalteten Problemanalyse (wo geht
das Gesundheitswesen hin, wo ist es überhaupt angebracht, Qualität zu messen und anzureizen?), die Entwicklung Problem-
bezogener Indikatoren (statt eines Daten-getriebenen Zählens von Parametern), das Bekenntnis zu Prozessindikatoren
bezüglich der Koordinationsproblematik in unserem Gesundheitssystem und die Relativierung der (übersteigerten)
Erwartungen an die Routinedaten – zugunsten klinischer Falldefinitionen z.B. analog der Infektionsepidemiologie.
In zweiter Linie sind organisationstheoretische Annahmen zu formulieren. Die monoprofessionelle Beschränkung des
Professionalismus-Konzeptes auf interne Motivation, Altruismus und Autonomie hat zu keiner tragfähigen Strategie geführt, die
Implementierung von P4P sollte daher einem multiprofessionellen Ansatz folgen, die Rollenverständnisse der beteiligten
Berufsgruppen weiterentwickeln und Konzepte des organisatorischen Wandels sowie des Kontextlernens mit einbeziehen.
Ganz entscheidend sind aber vor allem ökonomischen Festlegungen, ohne die P4P nicht erfolgsversprechend einzuführen
ist. Bei den Überlegungen zur Höhe der P4P-Vergütung müssen Opportunitäts- und Grenzkosten sowie Diskontierung mit
einbezogen werden, insbesondere wenn man eine Risikoaversion der Leistungserbringer und gegebenenfalls die Unsicherheit
einer Zahlung mit berücksichtigt. Letztere ist vor allem relevant, wenn man die Zahlung an eine relative Position in einer
Rankingliste (”die besten fünf”) koppelt, weil die einzelnen Einrichtungen erst spät einschätzen können, ob sich ihre Investition
in Qualität über die P4P- Vergütung “auszahlt”. Gestaffelte absolute Grenzwerte und die Vergütung relativer
Positionsverbesserungen sind daher vorzuziehen. Die principal agent - Theorie verweist auf die notwendige Abgrenzung von
P4P und der Einzelleistungsvergütung, letztere ist vorzuziehen, wenn die Informationsasymmetrie Qualitäts-relevanter
Leistungen z.B durch EBM aufgehoben ist (z.B. Blutkultur vor Antibiotika-Gabe bei der Pneumonie).
P4P sollte also auf Bereiche beschränkt werden, bei denen die Leistungserbringer einen deutlichen Wissensvorsprung bzgl.
des Zustandekommens der Versorgung aufweisen können, z.B. in der Behandlung von chronischen Erkrankungen. Die
Einbeziehung der Erkenntnisse der behavioural economics (Verhaltensökonomie) mit ihren Elementen framing, isolation effect
und Überschätzung relativer Risiken erbringt schon erste Empfehlungen für das weitere Vorgehen. Neben den
● Elementen Zeitnähe, Verlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Zahlungen, die aus der oben genannten Risikoaversion
resultieren, sind
● kleinere, häufigere Zahlungen mit on/off-Charakteristik wirkungsvoller als größere aber nur selten gezahlte Summen (z.B. im
Rahmen des Gesamterlöses eines Krankenhauses),
● die Einbehaltung von Vergütungsbestandteilen der stärkere Anreiz als die zusätzliche Vergütung (Verlust-Aversion),
● die Indikatoren sollten “unverbraucht” sein und nicht schon vorher Gegenstand anderer Systeme (z.B. Public Reporting)
gewesen sein, weil dann kein weiterer Effekt mehr auftritt (ceiling), und
● ein P4P-Programm sollte nicht gleichzeitig mit mehreren anderen Regelungen eingesetzt werden (isolation effect).
Insbesondere bei Ergebnisindikatoren muss die Risikoadjustierung optimal gestaltet werden, weil sich ansonsten bei
Erkrankungen mit niedriger Inzidenz vor allem kleinere Einrichtungen wegen des Morbiditäts- und Komorbiditätsrisikos nicht
an dem P4P-Programm beteiligen bzw. alternativ Risikoselektion betreiben. Daher sind Prozessindikatoren, die keiner
Risikoadjustierung bedürfen, zu präferieren, evtl. ergänzt durch einige Ergebnis- (z.B. adjustierte Mortalität) und
Strukturindikatoren.
Da - wie bereits angemerkt - P4P grundsätzlich in bestehende Vergütungssysteme (z.B. DRG) “eingebettet” wird, sind
die Wechselwirkungen mit diesen Systemen von großer Bedeutung für dessen Wirkung. Das deutsche Gesundheitssystem ist
sehr Mengen-orientiert, stark sektoral gegliedert, wenig auf Prävention ausgerichtet und vor allem fokussiert auf
Akuterkrankungen statt auf chronische und Mehrfacherkrankungen. Beabsichtigt man nun, durch P4P dem Mengenanreiz
einen Qualitäts-Anreiz entgegenzusetzen (”Qualität statt Menge”), dann ist dies gerade bei den Vergütungssystemen mit dem
größten Mengenanreiz (Einzelleistungsvergütung und DRG) besonders schwierig, weil dort die Opportunitätskosten am
höchsten und die Grenzkosten am niedrigsten sind (”ein Fall geht noch”). Es besteht sogar die Gefahr, dass bei
Einzelleistungsvergütung und sektoralen Pauschalen der Mengenanreiz durch P4P verstärkt wird, und zwar wenn folgende
Bedingungen zusammentreffen:
(1) es handelt sich um Leistungen, bei denen die Möglichkeit zur Mengenausweitung besteht (z.B. Endoprothetik),
(2) es werden Indikatoren mit geringer Sensitivität bzgl der Qualitätsprobleme verwendet, wie es bei Indikatoren auf der Basis
administrativer Daten der Fall ist,
(3) mit den resultierenden Qualitätsdaten wird eine Mengenausweitung begründet und in den Verhandlungen mit den
Kostenträgern durchgesetzt,
(4) die notwendige Risikoadjustierung wird durch upcoding der Adjustierungsparameter als Grundlage für ein gaming genutzt
(Pseudoverbesserung), und eventuell wird zusätzlich
(5) eine aktive Risikoselektion mit Attraktion leichterer Fälle betrieben, weil die Einrichtung aufgrund ihrer Größe mit eigenen
Daten eine Risikobewertung ihrer Patienten vornehmen kann.
Sieht man allerdings von einem Einsatz bei Krankheitsbildern bzw. Eingriffen ab, die einer Mengenausweitung zugänglich
sind, können bei Einzelleistungsvergütung und sektoraler Pauschalierung durchaus interessante Einsatzmöglichkeiten für P4P
darin bestehen, die Koordination der Behandlung und überhaupt die Behandlung von chronischen Erkrankungen zu
verbessern. Man kann den Nachteil chronischer Erkrankungen aus dem nicht-operativen Bereich, der dadurch entsteht, dass
der primäre ökonomische Anreiz bei diesen Vergütungsformen eher auf operativ zu behandelnde Akuterkrankungen gerichtet
ist, versuchen auszugleichen und hätte damit eines der dringensten Qualitätsprobleme in Deutschland aufgegriffen. Gleiches
gilt für auch für andere Themen wie Patientensicherheit (z.B. Indikatoren zur Einführung und sinnvollen Handhabung von
Instrumenten wie CIRS). In den genannten Fällen sind Prozessindikatoren sinnvoll einzusetzen, die keiner Risikoselektion
bedürfen. In Kombination mit höhergradig pauschalierenden Vergütungssystemen (integrierte transsektorale Versorgung,
Erkrankungspauschalen, Managed Care), die mehr Gewicht auf die Koordination der Behandlung und die Versorgung von
Patienten mit chronischen, multiplen Erkrankungen legen, kann man mit einem gezielten Einsatz von P4P sinnvoll eingreifen
und Schwerpunkte in der Qualitätsentwicklung setzen (s. QOF-Projekt in Großbritannien). Ähnlich es es durch einen
adäquaten Einsatz von P4P grundsätzlich möglich, den vor allem durch Diskontierungsaspekte gehemmten Einsatz der
Prävention zu fördern, ohne dabei den Grundanreiz der jeweiligen Vergütung zu verändern.
Das Rahmenkonzept wird abgerundet durch die politische Ebene.
Expertenorganisation und Komplexitätstheorie weisen den Institutionen und
den professionellen Strukturen der Selbstorganisation eine wichtige Rolle zu,
gerade die korporatistischen Strukturen der Selbstorganisation, in
Deutschland unter dem Begriff der Selbstverwaltung zusammengefasst, sind
in den letzten beiden Jahrzehnten immer wichtiger geworden, parallel zur
Wandel des politischen Grundverständnisses weg von einem hierarchischen
Modell zu Konzepten wie dem Governance-Konzept. Dieser Wandel ist
durchaus als funktional zu bezeichnen, entspricht er doch auf der
organisatorischen Ebene der Expertenautonomie, auf der Systemebene der
Komplexität des Gesundheitssystems, in Bezug auf die notwendige
Verhaltensänderung den Kontext-bezogenen Theorien und hinsichtlich der
ökonomischen Grundannahmen den verhaltensökonomischen
Erkenntnissen.
Es werden jedoch vier Punkte herausgearbeitet, in denen es keine
Alternative zur Übernahme der Verantwortung durch die politische Ebene gibt:
● die Richtung muss vorgegeben werden (direction pointing ist als Begriff in
“Crossing the Quality Chasm” eingeführt worden),
● strategische Ziele müssen gesetzt werden, weil die Auswahl der Indikatoren
weder zufällig noch aus Opportunität erfolgen darf,
● potentielle negative Auswirkungen müssen kontrolliert werden, und
● es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Hintergrund für die Initiierung des politischen Prozesses, für
die Implementierung, die Umsetzung und die Evaluation bilden.
Weitere Aspekte von “Qualität 2030”:
Das Gutachten steht hier zum Download bereit (weiterhin die Presseerklärung, Beilage Tagesspiegel am Vortag, Link zur
entsprechenden MWV-Webseite).









Prof. Dr. med. Matthias Schrappe

10

Seite
10

Seite











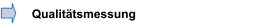
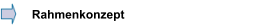
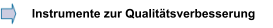
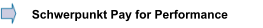
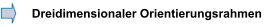
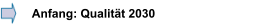
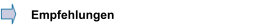


Kommentare

