20.11.2014 “Qualität 2030 - die umfassende Strategie für das
Gesundheitswesen” - Fortsetzung 2 -
Zur Qualitätsmessung: Erkenntnisinteresse und Instrumente
Die Diagnose- und Prozeduren-bezogene Externe Qualitätssicherung nach
§137a beschränkt sich unter streng sektoralem Blickwinkel auf die stationäre
Gesundheitsversorgung und selbst dort auf wenige Bereiche der operativen
Akutmedizin: 23 von 31 Krankheitsbildern/Prozeduren
betreffen die Transplantationsmedizin, die
Herzerkrankungen und die Endoprothetik. Dieser Dominanz
von akutmedizinischen und operativen Thematiken, die zum größten Teil aus der Maximalmedizin
stammen, steht gerade ein einziges Krankheitbild aus der konservativen Medizin gegenüber
(ambulant erworbene Pneumonie). Eine Konsequenz dieses Ungleichgewichts besteht darin, dass
die konservative Medizin von einem (angenommenen) Verbesserungsimpuls durch die vergleichende
Qualitätssicherung ausgeschlossen wird.
Die Entwicklungsnotwendigkeiten des deutschen Gesundheitswesens („fünf Ziele“) werden ignoriert
(sog. „blinde Flecken“): Indikatoren zu chronischen Erkrankungen, Mehrfacherkrankungen, zur
Behandlungsbedürftigkeit älterer Menschen und zur Integration bzw. Koordination der Versorgung
werden weder erhoben noch entwickelt. Das gleiche gilt für Indikatoren zur Ablösung der
Mengenorientierung der Vergütung, zur Förderung der Prävention oder zum Patienten- statt
Anbieterbezug. Zum Teil liegen Daten vor (z.B. Aufnahmegrund unerwünschtes Arzneimittelereignis),
werden aber nicht ausgewertet.
Drei unterschiedliche Zugänge zur Qualitätsmessung mit unterschiedlichem Einsatzbereich sind zu unterscheiden: Es sind
● quantitative Verfahren (z.B. Erhebung nosokomialer Infektionen),
● Monitoring-Verfahren (Indikatoren) und
● generierende Verfahren (zur Identifikation „blinder Flecken“ z.B. durch CIRS)
zu unterscheiden. Quantitative Verfahren ergeben valide Informationen z.B. über
Komplikationen oder Patientenerfahrungen, Sensitivität und Spezifität stehen in
einem ausgewogenen Verhältnis. Bei den Indikatoren (Monitoring) stehen die
Anforderungen an die Sensitivität ganz oben auf der Prioritätenliste, denn man will
in der Vorhersage unerwünschter Ereignisse immer gewarnt sein. Sowohl
quantitative Verfahren als auch Indikatoren können jedoch nur messen, was als
Parameter bekannt ist (gleiches gilt für andere klinisch-epidemiologische Verfahren
wie die Regressionsanalyse). Gerade im Rahmen der Diskussion um die
Patientensicherheit sind daher explorative bzw. generierende Verfahren in den
Vordergrund gerückt, die Informationen über Ereignisse liefern, die vorher
unbekannt waren. Neben dem CIRS (Critical Incident Reporting System) sind hier
Morbidity-Mortality-Konferenzen und z.B. die Analyse von Patientenbeschwerden
zu nennen. Gemeinsam ist diesen generierenden Verfahren, dass sie keine
nennenswerte Sensitivität aufweisen, also zum Vergleich über die Zeit oder
interinstitutionell nicht zu verwenden sind. Bemerkenswerterweise führt das Sozialgesetzbuch V alle drei existierenden
Datentypen für Qualitätssicherung und -management auf.
Ein Indikator sagt Qualitätsprobleme voraus: Indikatoren sind ein indirektes Maß für
Qualität, und hinsichtlich ihrer Vorhersagefunktion sollten sie möglichst sensitiv sein.
Sie werden aus mehreren Parametern anhand ihrer Sensitivität ausgewählt
(Selektion), sollten veränderbare Sachverhalte beschreiben und können (vor allem bei
falscher Anwendung) durchaus auch unerwünschte Folgen haben, z.B. teaching to the
test, also die Konzentrierung aller Anstrengung auf die Bereiche, die mittels
Indikatoren beobachtet werden, unter Vernachlässigung anderer Bereiche.
Administrative Daten sind wegen ihres Sensitivitätsproblems grundsätzlich als
Qualitätsindikatoren schlecht geeignet. Patientensicherheitsindikatoren haben
besonders hohe Anforderungen an die Sensitivität. Die Validierung von Indikatoren
kann durch empirische Untersuchungen (Vergleich mit Goldstandard) oder durch
einen EBM-gestützten Konsensprozess erfolgen.
Indikatoren weisen eine „intrinsische Ungerechtigkeit“ auf, denn sie können niemals gleichzeitig über eine 100%ige
Sensitivität und eine 100%ige Spezifität verfügen. Will man möglichst alle Qualitätsprobleme erkennen (hohe Sensitivität), wird
es immer einige als fälschlicherweise als auffällig identifizierte Einrichtungen geben. Aus dieser Tatsache folgt, dass die
Setzung von Indikatoren immer auch eine normative (politische) Aufgabe ist und sie nicht vollständig von der Mesoebene (z.B.
Selbstverwaltungsorgane) übernommen werden kann, da diese nicht in der Lage ist, gerichtsfeste Abgrenzungen zu liefern
(Beispiel Mindestmengen).
Reliabilität und Validität haben bei quantitativen Erfassungsmethoden und bei
Indikatoren eine unterschiedliche Bedeutung: bei den quantitativen Verfahren wird (z.B.
anhand eines Goldstandards) die Validität des Messinstrumentes bestimmt, beim
Indikator dagegen die Vorhersagefunktion des gemessenen Wertes für das
Qualitätssziel. Es ist also ein großer Unterschied, ob man z.B. postoperative
Komplikationen als quantitativ zu erfassenden Parameter erfasst (durchaus ein wichtiger
Wert, aber kein Indikator) oder als Indikator mit Vorhersagefunktion für die Qualität der
Versorgung (z.B. der operativen Medizin in einem Krankenhaus). Analog sind
Indikatoren (hohe Sensitivität) von klinischen diagnostischen Verfahren abzugrenzen,
bei denen vor allem falsch-positive Befunde, die fälschlicherweise zur Diagnosestellung
führen, bzw. der Positive Prädiktive Wert (PPW) entscheidend sind.
In der Qualitätssicherung nach §137 SGB V werden Qualitätsparameter als Indikatoren
bezeichnet, die lediglich der quantitativen Erfassung dienen. Die Validität von
quantitativen Methoden bezieht sich auf die Messung des unerwünschten Ereignisses,
die Validität von Indikatoren darauf, ob das gemessene Ereignis andere Ereignisse bzw.
die Qualität vorhersagt. In der Qualitätsssicherung nach §137 SGB V werden sehr oft
Qualitätsparameter erhoben, deren Indikatorenfunktion nicht belegt ist (s.u. Mortalität).
Ergebnisindikatoren sind nur auf den ersten Blick Prozessindikatoren überlegen, auf
den zweiten Blick weisen sie
● (1) wegen des Anreizes zur Risikoselektion,
● (2) wegen der daraus resultierenden Notwendigkeit der Risikoadustierung (die kaum je
komplett ist und über die Nebendiagnosen im Modell Anreize zum gaming bietet),
● (3) wegen der unausweichlichen Benachteiligung von kleinen Einrichtungen wegen
kleiner Fallgruppen (Anfälligkeit für Einzelereignisse, gößere Streuung),
● (4) wegen der großen Bedeutung externer Faktoren (Komorbidität, Qualität in
Nachbarsektoren, Verlegungspraxis) und wegen
● (5) des ex post-Charakters („das Kind ist schon im Brunnen“)
große Nachteile auf.
Prozessindikatoren sind daher vorzuziehen, denn
● (1) sie stehen im Verantwortungsbereich einer Einrichtung,
● (2) sie machen (in den meisten Fällen) keine Risikoadjustierung notwendig und
● (3) benachteiligen daher nicht kleine Einrichtungen,
● (4) außerdem entsprechen sie der Sichtweise der Patientenerfahrungen und sind
● (5) durch ihren präventiven Charakter dem Qualitäts- und Risikomanagement-Gedanken näher als Ergebnisindikatoren (sie
fördern den kontinuierlichen Verbesserungsprozess).
● (6) Die großen internationalen Projekte (Value-Based Purchasing-Programm (VBP) der Krankenhäuser in den USA und das
Quality and Outcome Framework (QOL) in Großbritannien) stellen Prozessindikatoren deswegen ganz in den Mittelpunkt.
Im Verlauf können Ergebnisindikatoren jeweils nach Klärung der methodischen Probleme schrittweise integriert werden. Es
empfiehlt sich der Start mit häufig wechselnden Indikatoren aus dem Bereich der Patientensicherheit (unerwünschte
Ereignisse, Komplikationen, nosokomiale Infektionen) und Koordination (z.B. in der Behandlung von chronischen
Erkrankungen, sektorübergreifende Koordination).
Mortalität ist ein wichtiger Parameter für die quantitative Erhebung, aber kein valider Qualitätsindikator: Unabhängig von
seinen verschiedenen Ausführungen (in house, 30-Tage, 90 Tage, 1 Jahr, standardized mortality rate (SMR) etc.) wird dieser
Parameter von zu vielen nicht kontrollierbaren Effekten beeinflusst. Seine Erfassung ist
aber zum Vergleich auf Systemebene (z.B. von Krankenhausgruppen) und als Parameter
zur begleitenden Information durchaus sinnvoll, seine Zukunft wird in der
Qualitätssicherung von integrierten Populations-bezogenen Versorgungssystemen mit
hoher Patientenzahl und in der Analyse von Strukturbedingungen liegen. Besonders bei
der Verwendung von SMRs (risikoadjustierte Mortalität) auf der institutionellen Ebene
bzw. zum interinstitutionellen Vergleich ist vor gaming-Strategien (Risikoselektion
verbunden mit Alterationen der Verlegungspraxis und Upcoding der Komorbidität) zu
warnen, wozu besonders große Anbieter in der Lage sind.
Routinedaten sind für die Qualitätssicherung nicht sensitiv genug, aber sehr interessant
für Validierungs- und explorative Zwecke: Jedes Gesundheitssystem, das DRG einführt,
diskutiert die Nutzung der Abrechnungsdaten zu Zwecken der (konsekutiv eingeführten)
Qualitätssicherung. Das Hauptproblem der Verwendung von Routinedaten besteht
einerseits in der schwachen Reliabilität, da die Dokumentation starken Anreizen
hinsichtlich der Vergütungsrelevanz ausgesetzt ist (z.B. Dekubitus: bei älteren Patienten
wegen der zahlreichen Komorbiditäten unterdokumentiert, bei jüngeren Patienten
überdokumentiert). Routinedaten sind andererseits aber auch nicht sensitiv, denn sie
erfassen z.B. Komplikationen immer nur insoweit, als dass sie vergütungsrelevant sind
(selbst wenn man sie als rein quantitative Erfassung ansieht, aber sie sind erst recht
keine sensitiven Indikatoren). Routinedaten sind aber vorhanden und sollten daher differenziert, insbesondere zur Validierung
von klinischen Daten und zur Klärung von speziellen Sachverhalten eingesetzt werden.
Indikatoren auf der Basis von Patientenerfahrungen und Patient Reported Outcome Measures sind valide und relevant
sowie international gebräuchlich. Im Value-Based Purchasing Programm (VBP) in den USA machen sie 20% der P4P-
Zahlungen pro Jahr aus, und im Quality and Outcome Framework (QOL) in Großbritannien werden sie mit einem hoch-
bewerteten Composite-Indikator geführt. Patienten haben eine überaus realistische Einschätzung der Häufigkeit von
unerwünschten Ereignissen und Schäden im Gesundheitswesen und können als Grundlage für Untersuchungen über die
Qualität der Versorgung auf Populationsebene verwendet werden. Die auf einen Auftrag des GBA zurückgehende Entwicklung
von entsprechenden Indikatoren für Deutschland durch das AQUA-Institut sollten intensiviert werden. Entsprechende
Entwicklungen durch das „Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen“ sind zu begrüßen.
Die transsektorale Qualitätssicherung kann die sektorale Perspektive nicht überwinden: Keiner der 31 in der externen
Qualitätssicherung nach §137a SGB V aufgenommen Krankheitsbilder bzw. Prozeduren weist eine sektor-übergreifende
Perspektive auf, das AQUA-Institut hat aber gemäß dem gesetzlichen Auftrag eine kleine Zahl von transsektoralen Indikatoren
entwickelt. Da die Entwicklung sehr aufwändig ist, bleibt es naturgemäß bei einzelnen Diagnosen, für die eine transsektorale
Qualitätssicherung umgesetzt werden kann („transsektorale Tunnel“). Die Sektorlogik wird daher nicht aufgehoben, es ergibt
sich kein integriertes Bild für die Versorgung einer Population. Gleiches gilt für die Routinedaten-basierten Projekte des
Wido-Institutes, die für einzelne Diagnosen stationäre und ambulante Daten koppeln. Außerdem kann es hier nicht zu einem
sinnvollen Feedback kommen, denn den Krankenhäusern obliegt nicht die Verantwortung für die poststationäre ambulante
oder rehabilitative Behandlung. Die Krankenhäuser können weiterhin nicht auf die de-anonymisierten Daten zugreifen und die
Fälle nicht analysieren, so dass ein Lerneffekt nicht möglich ist.
Area-Indikatoren beschreiben die Versorgung von Populationen und müssen wegen der fortschreitenden Integration
rechtzeitig entwickelt werden: Die Alternative zur sektoralen Perspektive ist nicht die transsektorale Perspektive, sondern die
Populationsperspektive. Die Entwicklung in Deutschland kann sich auf eine relativ große Anzahl von Versorgungsformen
stützen (zuletzt ambulante spezialärztliche Versorgung), so dass die Tendenz zur Integration langsam aber stetig zunimmt. Die
Qualitätsdiskussion muss diese Entwicklungen antizipieren, damit rechtzeitig Indikatoren vorliegen, die die unerwünschten
Effekte hochgradig integrierter Konzepte beschreiben können. Es ist auch die Übernahme der Versicherungsfunktion durch die
kooperierenden Leistungserbringer mit einzubeziehen (Aufhebung des provider-payer splits in Managed Care), die zwar eine
wünschenswerte Tiefe und Breite der Integration gewährleistet, aber auch Nebeneffekte wie Vorenthaltung von Leistungen mit
sich bringen kann.
Weitere Aspekte von “Qualität 2030”:
Das Gutachten steht hier zum Download bereit (weiterhin die Presseerklärung, Beilage Tagesspiegel am Vortag, Link zur
entsprechenden MWV-Webseite).









Prof. Dr. med. Matthias Schrappe

10

Seite
10

Seite









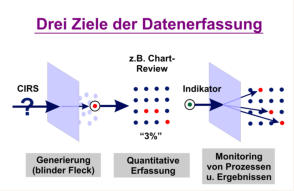

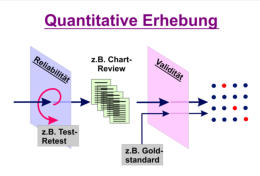
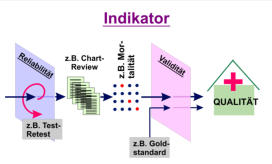
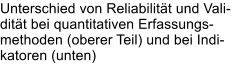



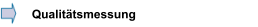
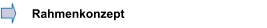
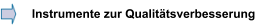
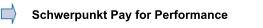
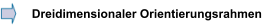
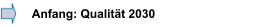
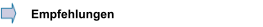
Kommentare

