







26.02.2017 Stellungnahme zum Methodenpapier des IQTIG
“Methodische Grundlagen” Version V1.0s
Anfang Februar 2017 ist das erste Methodenpapier des Institutes für Qualität und
Transparenz im Gesundheitswesen als Grundlage für das Stellungnahmeverfahren
erschienen. Hier eine erste orientierende Stellungnahme (Fassung 26.2.2017):
1. Einführung
Das nun in einem ersten Entwurf vorliegende Methodenpapier des Institutes für Qualität und Transparenz im
Gesundheitswesen (IQTIG) weist einige positive Aspekte auf (z.B. Zielorientierung des Qualitätsbegriffes, Qualitätsmodell als
Voraussetzung für die Identifikation von Indikatoren), bleibt aber in seinen Grundannahmen einem traditionellen, auf die ex
post-Qualitätskontrolle von Ergebnissen ausgerichteten Verständnis von Qualität verhaftet. In den folgenden Ausführungen
darf selbstverständlich nicht vergessen werden, dass das Institut an die
Ausführungen des Gesetzgebers und die Anforderungen des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA) gebunden ist. Trotzdem wäre zu fordern, dass das
Institut die notwendige Fortentwicklung des statischen, auf die Sicherung von
Qualität ausgerichteten Verständnisses zu einem international anschlussfähigen
Konzept der Qualitätsverbesserung (quality improvement) nicht nur anspricht,
sondern in den Mittelpunkt der perspektivischen Entwicklung stellt.
2. Allgemeines
Das Methodenpapier gliedert sich in drei Teile: Grundlagen (Teil A), Entwicklung
und Durchführung (Teil B) und methodische Elemente (Teil C). Das Methodenpapier
behandelt die „wissenschaftlichen Methoden, die den Entwicklungen und
Weiterentwicklungen von QS-Verfahren zugrunde liegen“ (S. 13), Andererseits wird hervorgehoben, es handele sich „weder
[um] ein Lehrbuch für Qualitätssicherung noch beinhaltet es eine Abhandlung der Geschichte der medizinischen
Qualitätssicherung“ (S. 13).
In der Auseinandersetzung mit dem Methodenpapier, das für die weitere Entwicklung der Qualitätsdiskussion im deutschen
Gesundheitswesen eine wichtige Rolle spielen wird, kann man von zwei unterschiedlichen Positionen ausgehen:
(1) Aus der Perspektive einer normativen Position muss klar konstatiert werden, dass in dem vorliegenden Methodenpapier
zahlreiche grundlegende Definitionen verwendet werden, die nicht dem gängigen wissenschaftlichen und praktischen
Verständnis entsprechen. Grundlegende Quellen, die in Deutschland in den letzten 20 Jahren für die Qualitätsdiskussion und
vor allem auch für die Lehre, die Aus- und die Fortbildung der Gesundheitsberufe in diesem Bereich Gültigkeit hatten, werden
nicht berücksichtigt, insbesondere
- das von der Bundesärztekammer, der kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Arbeitsgemeinschaft der
Medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften (AWMF) herausgegebene „Curriculum Qualitätsmanagement“
(Bundesärztekammer 2007),
- die aktuelle Ausgabe der DIN-Vorschriften (s. DIN-TERM online 2017),
- die aktuellen Begriffsbestimmungen der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der
Gesundheitsversorgung (GQMG) und der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und
Epidemiologie (GMDS) (das sog. „QM-Glossar“ (Sens et al. 2007), derzeit in Überarbeitung) und
- die internationale Literatur (z.B. Nomenklatur der Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ).
Die verwendeten Begriffsbestimmungen weichen in dem Methodenpapier durchaus nicht nur graduell von den in diesen (und
anderen) Quellen verwendeten Definitionen ab.
(2) Aus der wissenschaftlichen Perspektive ist festzuhalten, dass das Methodenpapier nicht der aktuellen Diskussion über
den Qualitätsbegriff entspricht, wie sie z.B. im Rahmen der Versorgungsforschung (aber auch darüber hinaus) geführt wird.
Die Versorgungsforschung geht davon aus, dass Begriffe und Konzepte im Gesundheitswesen nur im Rahmen komplexer
Kontextbedingungen zu verstehen und quantitativ zu fassen sind. Gerade solche Konstrukte wie die Qualität der
Gesundheitsversorgung basieren auf Aushandlungsprozessen über „Merkmale“ und „Anforderungen“, die dem Qualitätsbegriff
zugrunde liegen und eine direkte, lineare Messung wie im biomedizinischen Kontext nur in Ausnahmefällen möglich machen.
Zusätzlich ist zu bedenken, dass jeder Ansatz einer „Qualitätsmessung“ selbst als Intervention aufzufassen ist, die die
Merkmale und Anforderungen sofort und nachhaltig verändert. Man muss sich daher über die Messmethodik (primär) und die
Datenquellen (sekundär) sehr genau Rechenschaft ablegen; im geplanten breiten Einsatz von Indikatoren als Instrumente
einer Qualitätsverbesserung auf Systemebene (Public Reporting oder Pay for Performance) können diese nur als Monitoring-
Instrumente konzipiert werden, die hoch-sensitiv eingestellt werden (s. Abb. 1). Messmethoden wie bei wissenschaftlichen
Studien oder begrenzten klinisch-epidemiologischen Erhebungen scheiden wegen des damit verbundenen Messaufwandes
aus (s. Abschnitt 3.3.). Monitoring-Instrumente müssen dabei durch wissenschaftliche Erkenntnisse angeleitet sein, können
aber in den meisten Fällen nicht vollständig durch wissenschaftliche Erkenntnisse begründet werden (Beispiel: Mindestmengen
als Qualitätsindikator – Problematik der Grenzwerte).
Ebenso wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen (z,B. Verkehrssicherheit: Geschwindigkeitsbegrenzung in geschlossenen
Ortschaften) müssen sie wissenschaftlich abgeleitet,
aber letztlich politisch gesetzt werden, um im Kontext
weiterer Maßnahmen übergeordneten
gesellschaftlichen Zielen gerecht zu werden. Nicht in
jedem Fall ist es möglich, z.B. die Grenzwerte (z.B. 50
oder 55 km/h) valide abzuleiten oder in jedem Einzelfall
eine konkrete Gefährdung nachzuweisen. Neben den
genannten Mindestmengen sind daher Indikatoren über
den Zugang zur Versorgung und zur regionalen
Versorgung von hoher Bedeutung, da sie unmittelbar in
den Bereich der politischen Handlungskompetenz
fallen; allerdings ist dafür ein politisches
Rahmenkonzept notwendig, wie es z.B. in den USA
durch Crossing the Quality Chasm gegeben ist (IOM
2001).
Im konkreten Zusammenhang mit der Qualitätsthematik
heißt dies: die ex post-Qualitätskontrolle mittels
Ergebnisparametern scheitert nicht nur an ihrer
mangelnden Integration in den Prozess der
Leistungserbringung, auch nicht an der (niemals
vollständigen) Risikoadjustierung, sondern an der
mangelnden biometrischen Spezifizierung (zu niedrige
Sensitivität) und letztlich an der fehlenden
übergeordneten Zielsetzung.
Dabei muss betont werden, dass das Methodenpapier des IQTIG sehr komplex und ehrgeizig ist und in Teilen (z.B. in den
Ausführungen zum „Qualitätsmodell“) innovative Gedanken verfolgt, die durchaus diskussionswürdig erscheinen. Der
Aufeinanderfolge von Qualitätsaspekten, Qualitätsmerkmalen und Qualitätsindikatoren kann man sicher einiges abgewinnen,
eventuell ergibt sich hier die Möglichkeit, der Zielorientierung des Qualitätsbegriffes und von Indikatoren auch langfristig
bessere Sichtbarkeit zu gewähren. Man muss aber intensiv über die Grundannahmen diskutieren, die dem Methodenpapier
zugrunde liegen, insbesondere zum Verständnis von Qualität, zur Qualitätsdarstellung, der Bestimmung von Qualität (als
Qualitätsmessung bezeichnet) und zum hier verwendeten Konzept der Qualitätsindikatoren sowie deren Validität.

Kontakt: matthias@schrappe.com
Impressum
21

Seite

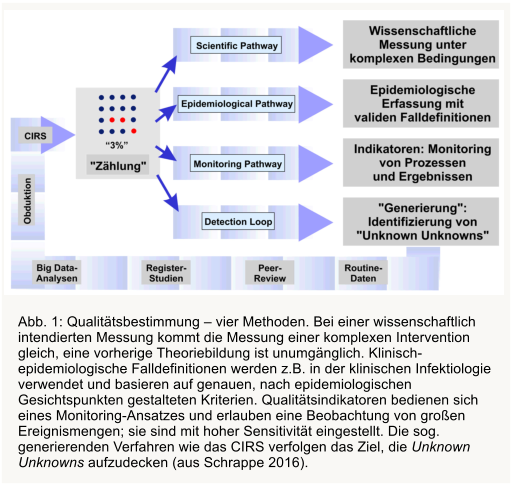







Printversion hier zum Download


21

Seite

21

Seite

Im Weißbuch
