







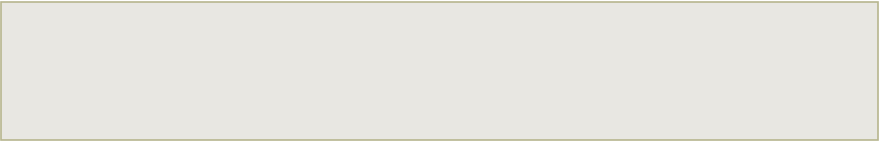
26.02.2017 Stellungnahme zum Methodenpapier des IQTIG
“Methodische Grundlagen” Version V1.0s
(Fortsetzung 1)
3. Konzeption und Qualitätsverständnis
3.1. Qualitätsverständnis
Das dem Methodenpapier zugrunde liegende Qualitätsverständnis wird vor allem in
den Kap. 2.1 und 2.2. ausgeführt (S. 16 ff). Ausgehend von einer sachlich richtigen
Definition von Qualität, die auf den Begriffen „inhärente Merkmale“ und „Anforderungen“ basiert, wird die Dimension der
Patientenzentrierung besonders hervorgehoben, flankiert durch „Systemqualität“ (ein unüblicher Begriff, den man aber prägen
kann), den Zugang und „equity“ (Gleichheit) (S. 16).
Diese Dimensionen können als relevant gelten, aus Sicht der
Versorgungsforschung ist besonders die Betonung der Patientenzentrierung positiv
zu werten. Die getroffene Auswahl ist jedoch vor dem Hintergrund der national und
international geltenden Dimensionen und Rahmenkonzepte als unvollständig und in
ihrer Auswahl nicht begründet zu werten. So sind im allgemein als grundlegend
geltenden Konzept der „Seven Pillars“ von Donabedian (1990) die sechs
Dimensionen efficacy, effectiveness, efficiency, acceptability, optimality, legitimacy
und equity enthalten; das auch vom AQUA-Institut genutzte OECD Konzept
umfasst effectiveness, safety, timeliness und patient-centeredness (Arah et al.
2006); das aktuelle AHRQ-Konzept umfasst die Attribute safe, effective, patient-
centered, timely, efficient und equitable (AHRQ 2017).
In Kap. 2.2. kommt zu dieser wenig begründeten Auswahl noch der Umstand hinzu,
dass aus der Dimension „Legitimität“ eine Art Meta-Kriterium konstruiert wird:
„Eine objektive, Vergleiche ermöglichende Darstellung von Versorgungsqualität setzt voraus, dass eine begrenzte Anzahl
legitimer Anforderungen an die Versorgung identifiziert und explizit gemacht wird.“ (S. 17)
Die Begründung wird darin gesehen, dass
„… diese Anforderungen der externen Qualitätssicherung Grundlage für Verbesserungsinitiativen und
Steuerungsverfahren im Gesundheitswesen sein sollen“ (S. 17)
und sie daher „in besonderer Weise legitimiert sein“ müssen. Die Kriterien für diesen Begriff der Legitimität werden genau
genannt und lauten
- Patientenzentrierung,
- Beeinflussbarkeit durch die Leistungserbringer und
- Unbedenklichkeit.
Es wird also a priori eine Auswahl der in Frage kommenden Dimensionen getroffen. Diese Auswahl muss sowohl in ihrer
Konstellation als auch in ihrer Ausführung kritisch gesehen werden:
- Patientenzentrierung: Der Begriff der Patientenzentrierung wird im Methodenpapier ausgesprochen häufig verwendet.
Man wird den Verdacht nicht los, dass hier eine Art Augenscheinvalidität aufgebaut wird, da gegenwärtig
Patientenzentrierung gerade im Rahmen der Versorgungsforschung ein so prominentes Thema darstellt. In der
Umsetzung zeigt sich aber, dass Patientenzentrierung in einer sehr paternalistischen Weise verstanden wird, in dem sie
ausschließlich auf die Ergebnisqualität bezogen wird. Dagegen zeigen entsprechende Untersuchungen, dass Patienten in
viel stärkerem Maße an Fragen der Strukturqualität (z.B. Ausbildung der Ärzte) sowie an Kooperation, Koordination und
Information (also eindeutigen Prozessparametern) interessiert sind (aus der umfangreichen Literatur: Geraedts und de
Cruppé 2011, Schoen et al. 2011). Die einseitige Betonung der Ergebnisqualität erscheint auf den ersten Blick sinnvoll,
führt aber zu einer reinen ex post-Betrachtung im Sinne eines Qualitätskontroll-Ansatzes, statt zu einer Integration von
Qualitätsaspekten im Prozess der Leistungserbringung im Sinne eines kontinuierlichen Qualitätsverbesserungsansatzes
(continuous quality improvement). Die Fokussierung auf die Patientenzentrierung erscheint auch vor dem Hintergrund der
derzeitigen Diskussion um die Regionalität der Versorgung nicht als einziger Blickwinkel sinnvoll zu sein, denn neben den
präferenz-sensitiven Aspekten, zu denen Patientenzentrierung zu rechnen ist, sollte man mindestens noch die Dimension
der Wirksamkeit und Anbietersensitivität mit einschließen (Wennberg et al. 2002, s. auch Frosch et al. 2010).
- Beeinflussbarkeit durch die Leistungserbringer: Dieses Kriterium ist genau genommen keine Qualitätsdimension,
sondern stammt aus der Bewertung von Qualitätsindikatoren (z.B. RUMBA-Regel). So wie unter der Überschrift
„Beeinflussbarkeit durch den Leistungserbringer“ auf Seite 92 richtig dargestellt, ist dieser Aspekt bei der Auswahl von
Indikatoren wichtig, für die Entwicklung von Qualitätsdimensionen jedoch nachgeordnet, denn wenn Qualitätsprobleme
bestehen, die durch einen Leistungserbringer nicht beeinflussbar sind, dann bestehen sie dessen ungeachtet fort.
- Unbedenklichkeit: Diese Dimension erscheint zwar auf den ersten Blick sinnvoll, ist aber international und in den in
Deutschland gebräuchlichen Systematiken an keiner Stelle vorzufinden. Natürlich ist nichts dagegen zu sagen, dass „die
gestellten Anforderungen (…) keine für die Patientinnen und Patienten schädlichen Nebenwirkungen entfalten“ dürfen. Es
stellt sich allerdings die Frage, weshalb dann nicht Wirksamkeit oder Sicherheit im Sinne der gebräuchlichen
Systematiken direkt genannt werden.
Die vorherrschende Stellung der „Legitimität“ ist der wissenschaftlichen und praktischen Betrachtung von Qualität sowohl
im institutionellen und im Systemkontext weitgehend fremd (eine der wenigen Nennungen in Steffen 1988) bzw. darf als
selbstverständliche Grundbedingung gelten. Es scheint hier der Versuch vorzuliegen, eine juristische Absicherung der
Aktivitäten vorzunehmen, allerdings auf Kosten anderer Dimensionen des Qualitätsbegriffes, die hier durchaus sinnvoll hätten
aufgeführt und diskutiert werden können (optimality, acceptability, safety etc.). Klar wird dies in folgenden Ausführungen:
„Versorgungsqu
alität im Rahmen der extern vergleichenden Qualitätssicherung ist definiert als der Grad der Erfüllung
der legitimen Anforderungen, die durch das jeweilige QS-Verfahren normativ vorgegeben sind.“ (S. 20, Hervorh. der
Verf.)
“Die Qualität der Versorgung besteht in der Fähigkeit, bestimmte legitime Ziele zu erreichen (Steffen 1988). In der
externen Qualitätssicherung werden diese Ziele als legitime Anforderungen an die Leistungserbringer formuliert und
konkret über Qualitätsmerkmale dargestellt ...“ (S. 92, Hervorh. der Verf.).
Wie sehr der Gesichtspunkt der juristischen bzw. politischen Absicherung im Vordergrund steht, wird auch durch die starke
Betonung der statistischen Methodik klar. Gleich im Anschluss an die Ausführungen zur Legitimität heißt es hierzu (S. 19,
Hervorh. der Verf.):
„Die Fokussierung auf definierte, legitime Anforderungen ist eines der zentralen Charakteristika der externen
Qualitätssicherung. Ein zweites ist die primär statistische Herangehensweise an die Messung und Bewertung der
Versorgungsqualität der einzelnen Leistungserbringer im Vergleich zueinander. Die statistische Analyse von
Qualitätssicherungsdaten ist eine über den Einzelfall hinausgehende Betrachtungsweise und kann dadurch Aspekte der
Qualität quantitativ darstellen, die in Einzelfallanalysen nicht sichtbar werden. Die Bewertung der Versorgungsqualität
eines Leistungserbringers erfolgt anhand statistischer Daten der Versorgung von Patientinnen und Patienten, die dieser in
einem bestimmten Zeitraum (meist während eines Jahres) behandelte. Die externe Qualitätssicherung hat damit einen
anderen Schwerpunkt als etliche Instrumente der internen Qualitätssicherung, die mehr auf kasuistischen
Einzelfallbewertungen vor Ort beruhen…“
Abgesehen, dass der letzte Satz sachlich nicht zutreffend ist, sind statistische Fragen natürlich von großer Wichtigkeit, sie
stellen aber gegenüber der Zielformulierung und der Beschreibung der inhärenten Merkmale ein sekundäres Problem dar.
Das Qualitätsverständnis des Methodenpapiers entspricht dem Ansatz der Qualitätskontrolle aus der ex post-Perspektive.
Die diskutierten Qualitätsdimensionen sind auf Fragen der Legitimität und statistischen Auswertbarkeit reduziert, die
juristische Absicherung des Verfahrens steht ganz im Vordergrund. Sehr häufig wird der Begriff der Patientenzentrierung
genannt, jedoch in paternalistischer Tradition einseitig auf die Ergebnisqualität bezogen. Elemente der kontinuierlichen
Qualitätsverbesserung mit Integration des Qualitätsgedankens in den Ablauf der Leistungserbringung auf institutioneller
und Systemebene sind weitgehend in den Hintergrund gedrängt.








Printversion hier zum Download


21

Seite

Im Weißbuch


21

Seite
