







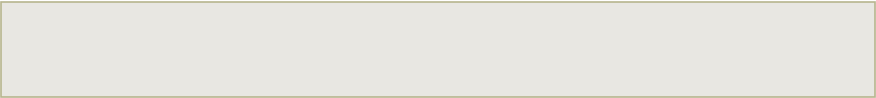
26.02.2017 Stellungnahme zum Methodenpapier des IQTIG
“Methodische Grundlagen” Version V1.0s
(Fortsetzung 4)
3.3.2. Verständnis von Qualitätsindikatoren
Nach diesen analytisch-inhaltlichen Ausführungen kommt man nicht umhin, wieder
zu normativen Fragen zurückzukehren (die sich daraus ableiten lassen), bevor im
nächsten Absatz das zweite inhaltliche Grundproblem der IQTIG-Position
angesprochen wird (unklare Abgrenzung von Reliabilität und Validität von Indikatoren).
Dem Methodenpapier des IQTIG kann man folgende Definitionen von
Qualitätsindikatoren entnehmen:
„Die Messung der Qualität medizinischer Versorgung erfolgt grundsätzlich
mittels Qualitätsindikatoren. Qualitätsindikatoren sind Konstrukte, die aus
Versorgungsdaten (Input) nachvollziehbare Bewertungen der
Versorgungsqualität (Output) ableiten“ (S. 21, Hervorh. der Verf.).
„Als Qualitätsindikatoren gelten leistungserbringerbezogene
Qualitätsmessungen, die ein konkretes Qualitätsziel verfolgen und eine
Qualitätsbewertung (…) ermöglichen“ (S. 52, Hervorh. der Verf.)
Wie oben bereits ausgeführt, geht das Methodenpapier davon aus, dass
Qualitätsindikatoren in der Lage sind, Qualität zu „messen“, und dass sie außerdem
der Bewertung von Qualität dienen können. Zum ersten Teil dieser Aussage wurde
in Abschnitt 4.3.1. schon Stellung genommen, der zweite Teil („Bewertung“) ist jedoch nicht weniger unzutreffend. Es kann hier
nicht die gesamte Literatur wiedergegeben werden, aber im „QM-Curriculum“ der Bundesärztekammer, KBV und AWMF (4.
Auflage) heißt es beispielsweise zur Definition von Qualitätsindikatoren (S. 73f):
“Quantitatives Maß, welches zum Monitoring und zur Bewertung der Qualität wichtiger Leitungs-, Management-,
klinischer und unterstützender Funktionen genutzt werden kann, die sich auf das Behandlungsergebnis beim Patienten
auswirken. Ein Indikator ist kein direktes Maß der Qualität. Es ist mehr ein Werkzeug, das zur Leistungsbewertung
benutzt werden kann, das Aufmerksamkeit auf potentielle Problembereiche lenken kann, die einer intensiven Überprüfung
innerhalb einer Organisation bedürfen könnten.“ Qualitätsindikatoren bilden die Qualität einer Einheit durch Zahlen bzw.
Zahlenverhältnisse indirekt ab. Man kann sie auch als qualitätsbezogene Kennzahlen („Qualitätskennzahlen“)
bezeichnen. Die Ausprägung eines Indikators kann mit guter bzw. schlechter Qualität in Verbindung gebracht werden.
Hierzu verwendet man definierte Ausprägungen des Indikators, den sog. Referenzwert oder Referenzbereich.
Qualitätsindikatoren sind struktur-, prozess- und/oder ergebnisbezogen. Darüber hinaus müssen Qualitätsindikatoren – je
nach Anwendung – den Anforderungen der Validität, Reliabilität, Sensitivität und Spezifität genügen.“
Diese Definition liegt mit den international gebräuchlichen Definitionen z.B. der Joint Commission auf einer Linie, wie sie auch
im „QM-Glossar“ der GMDS und GQMG vertreten werden:
“An indicator is a quantitative measure that can be used to monitor and evaluate the quality of important governance,
management, clinical, and support functions that affect patient outcomes. An indicator is not a direct measure of
quality. Rather, it is a tool that can be used to assess performance that can direct attention to potential performance
issues that may require more intense review within an organisation” (JCAHO 1991, Hervorh. der Verf.).
Im Methodenpapier werden nachfolgend „drei Komponenten“ erwähnt, die Indikatoren beinhalten sollen (S. 21):
„- einem konkreten Ziel für die Versorgungsqualität (z. B. „die Häufigkeit von Komplikationen soll möglichst gering sein“),
- einem spezifischen Dokumentations- und Messverfahren für das Qualitätsmerkmal (z. B. Spezifikation, Dokumentation,
Rechenregel) sowie
- einem Bewertungskonzept, das die Zielerreichung bewertet und einen Handlungsanschluss bietet (z. B.
Referenzbereich einschließlich Klassifikationsverfahren).“
Positiv ist hier zu vermerken, dass explizit die Zielorientierung von Qualitätsindikatoren hervorgehoben wird (vgl. Schrappe
2014, S. 68ff und 86ff), und auch die Forderung nach einer genauen Spezifikation ist selbstverständlich nicht zu kritisieren.
Allerdings steht die Annahme, zum Begriff des Indikators würde auch ein „Bewertungskonzept“ gehören, nicht im Einklang mit
den gängigen Definitionen. Sie basiert auf der sachlich falschen Überzeugung, Indikatoren könnten direkt Qualität messen und
insofern einen direkten „Handlungsanschluss“ liefern. Monitoring-Instrumente sind dazu jedoch nicht in der Lage, was
allerdings nicht ausschließen soll, dass man daran aus übergeordneten Gründen Handlungskonsequenzen knüpft (z.B. wie
das Bußgeld bei Geschwindigkeitsüberschreitung in geschlossenen Ortschaften). Der grundsätzliche Unterschied besteht hier
darin, dass das Methodenpapier impliziert, die „Bewertung“ bzw. der „Handlungsanschluss“ sei aus dem Indikator heraus
abzuleiten, während die richtige Position davon ausgeht, dass der Indikator lediglich als Ampel fungiert, die die
Aufmerksamkeit auf einen Handlungsbedarf lenkt und eventuell Handlungsoptionen auslöst, die aber extern abgeleitet sind. An
dieser Stelle schließt sich die wichtige Diskussion an, ob Indikatoren, die als Monitoring-Instrumente eingestellt sind, eigentlich
in P4P-Programmen oder zur Krankenhausplanung sinnvoll verwendet werden können4.
Die im Methodenpapier des IQTIG verwendeten Definitionsansätze von Qualitätsindikatoren entsprechen nicht den
gebräuchlichen Standards, insbesondere indem sie Qualitätsindikatoren als direktes Maß von Qualität ansehen und
diesem Begriff eine Bewertungsfunktion zuweisen.
-----
4 Sie können tatsächlich eingesetzt werden, obwohl dies zunächst kontraintuitiv erscheint (keine Messung, „nur“ Monitoring, wie sollen daraus
Entscheidungen abgeleitet werden?). In anderen Bereichen der Gesellschaft wird dies aber durchaus oft in dieser Weise gehandhabt (z.B. Ver-
und Gebote). Die Handlungskonsequenzen (z.B. Abschläge) müssen jedoch extern gesetzt werden und können nicht aus dem Indikator
abgeleitet werden, die „Handlungsanschlüsse“ stellen also keine genuine Indikatoreigenschaft dar.








Printversion hier zum Download


21

Seite

Im Weißbuch


21

Seite
