









16.05.2017 Aus aktuellem Anlass: Pay for Performance (P4P) oder die
Qualitäts-abhängige Vergütung - keine Magic Bullet, die Umsetzung
führt, es kommt auf die Details und den Kontext an
Bereits im Jahr 1997 plädierte der Sachverständigenrat (SVR
1997, Nr. 137) für “ergebnisbezogene Bonuszahlungen im
Rahmen mehrschichtiger Vergütungssysteme mit einer
Verknüpfung der Vergütung an zu entwickelnde Leitlinien”. Im
SVR-Gutachten 2007 folgte dann ein systematischer Review, der unter dem Begriff der Qualitäts-orientierten
Vergütung 28 kontrollierte Studien einschließen und eine Wirkung auf Prozess- und Ergebnisparameter
zeigen konnte (SVR 2008,Nr. 725ff, zusammenfassende Darstellung hier). Obwohl dieser Review eher die
kurzfristigen Ergebnisse abbildete und die etwas weniger deutlichen Langfristeffekte noch nicht einbeziehen
konnte, sind nachfolgende Reviews mit spezifischen Einschlusskriterien zu ganz ähnlichen Ergebnissen
gekommen: kleine Effekte, Schwerpunkt Prozessqualität, und wie zu erwarten: methodisch schwächere
Studien ergeben einen etwas größeren Effekt als methodisch stärkere Studien.
Das Thema P4P bzw. Qualitäts-abhängige/-orientierte Vergütung ist in dieser Webseite an zahlreichen Stellen genauer nachzulesen. Eine
sorgfältige Ausarbeitung zu “P4P: Aktuelle Einschätzung, konzeptioneller Rahmen und Handlungsempfehlungen” findet sich hier und ist dort
auch als pdf-Datei downzuloaden. Dieser Text wurde zuletzt 2014 aktualisiert, ist aber in seinen Ausführungen zur Organisationstheorie, zu
den ökonomischen Annahmen bzw. Rahmenbedingungen und zur politischen Verantwortung unverändert aktuell (Inhaltsverzeichnis); eine
Überarbeitung ist unterwegs (Juni/2017). Dieser Text bildete den Grundstock für das Gutachten “Qualität 2030” (Schrappe 2014) im Auftrag
von Gesundheitsstadt Berllin, erschienen 2014 in der Medizinisch-Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft (freier Download), das sich
schwerpunktmäßig dem Thema P4P und den zugrundeliegenden Fragestellungen widmet (Kurzdarstellung). Die aktuellen gesetzlichen
Regelungen werden hier gesondert dargestellt und kommentiert. Außerdem gibt es auf der Download-Seite zahlreiche Vorträge zum Thema
(z.B. auf dem 9. Nat. Qualitätskongress 2015).
Heute, d.h. am Ende der 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages, hat sich P4P - allen Bedenken zum Trotz -
international durchgesetzt und kommt in 14 OECD-Staaten zur Anwendung (Milstein und Schreyögg 2016). In Deutschland steht
die sog. “Qualitätsoffensive” der Großen Koalition im Vordergrund, die vor allem i.R. des Krankenhausstruktur-Gesetzes (KHSG
vom 22.12.2015) versucht, neben der Leistungsmenge auch Qualitätsaspekten Vergütungsrelevanz zu verschaffen (s. Abb. 1). Dies
geschieht im Krankenhausbereich in erster Linie durch die Qualitäts-abhängige Vergütung und die sog. Qualitätsverträge,
außerdem gibt es analoge Regelungen in der ambulanten und zahnärztlichen Versorgung (s. Abb. 1). Das Institut für Qualität und
Transparenz (IQTIG) hat am 20.10.2016 vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) den Auftrag bekommen, Leistungsbereiche
zu definieren und Indikatoren zu entwickeln, die sich für
Zu- und Abschläge eignen. In zwei Schritten sollen im
Laufe des Jahres 2017 zunächst Indikatoren aus dem
Beritt der externen Qualitätssicherung nach §136 Abs. 1
SGB V bzw. der darauf basierenden QSKH-Richtlinie des
G-BA (G-BA 2016) identifiziert werden und in einem dritten
Schritt ab 2018 dann “neue” Indikatoren hinzukommen, die
vorher noch nicht im Rahmen der
Qualitätsberichterstattung (Public Reporting) in Gebrauch
waren.
Allerdings ist nicht zu übersehen, dass in Deutschland
sowohl in den Fachkreisen als auch in den Verbänden
und in der Wissenschaft eine weitverbreitete
Ablehnung von P4P besteht. Man bezieht sich immer
wieder auf das Gutachten des BQS-Institutes von 2012,
das im Auftrag des BMG und unter Leitung des damaligen
Institutsleiters und jetzigen IQTIG-Chefs Christof Veit zu
einer ablehnenden Haltung gekommen war (Veit et al.
2012), allerdings einige methodische Mängel aufweist (zu
weite Fassung des Begriffs, zu weiter Einschluss von
Evidenz, s. hier). Ein weiterer Grund mag darin liegen, dass
die Zustimmung oder Ablehnung von P4P immer global erfolgt und man nicht die differenzierten Einsatz-möglichkeiten und
Rahmenbedingungen berücksichtigt. Die globale Diskussion der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von P4P ist ungefähr genauso
sinnvoll wie die Diskussion der Frage, ob Chemotherapie bei Tumorerkrankungen wirkt, was eine in ihrer Undifferenziertheit völlig
sinnfreie Problemstellung darstellt. Es ist eben so: bei manchen Tumoren und klinischen Situationen ist Chemotherapie eine gute
Option (die Chancen überwiegen die Risiken), in anderen Situationen schadet sie viel mehr als sie nutzt. Genauso ist es mit einer
Systemintervention wie P4P: es gibt ungeeignete Einsatzoptionen (s.u.), es ist aber sehr sinnvoll, über einen Einsatz von P4P in
spezifischen Situationen zu Unterstützung gewünschter Systementwicklungen im Gesundheitswesen nachzudenken. Als Beispiel
sei hier die Verbesserung der Kooperation und Information bei der Betreuung von chronisch mehrfacherkrankten Patienten in einer
regional organisierten Gesundheitsversorgung genannt. Andere Gesundheitssysteme haben es sehr gut verstanden, P4P-Elemente
in eine übergeordnete Weiterentwicklungsstrategie des Gesundheitssystems zu integrieren (Ashton 2015).
In diesem Zusammenhang fällt zudem auf, dass die vorhandene
wissenschaftliche Literatur oft sehr einseitig zitiert wird, indem
z.B. nur Systematische Reviews mit überwiegend negativem
Ergebnis Eingang finden, als Beispiel sei hier der Review von
Kondo et al. (2015) genannt. Bemerkenswerterweise stammt aus
der gleichen Gruppe ein aktuell veröffentlichter Review, der
zumindestens auf Prozessparameter einen durchaus (wiederum
nicht übermäßig großen) positiven Effekt beschreiben konnte
(Mendelson et al. 2017). Der Systematische Review von Ogundeji
et al. (2016) sah sich sogar in der Lage, eine Metaanalyse an 34
Studien durchzuführen: über die Gesamtheit der Studien, über die
unkontrollierten Studien UND auch über die randomisierten
höherwertigen Studien war ein statistisch relevanter positiver
Effekt nachzuweisen (Abb. 2).
So “schlecht” sieht der Sachstand also gar nicht aus. Die
vorgenannten Befunde, das muss man allerdings klar
hervorheben, zeigen aber auch ganz deutlich: P4P ist kein
Magic Bullet, die zu erwartenden Effektmaße sind eher
gering. Aus Sicht der Versorgungsforschung ist diese Diskussion des Erwartungshorizonts ein interessanter Befund, denn es
handelt sich bei P4P um eine sog. complex mutlicomponent intervention (CMCI) auf Systemebene. Diese CMCI’s stellen den
Prototyp der von der Versorgungsforschung untersuchten und in der Realität der Gesundheitsversorgung anzutreffenden
Interventionen dar (Berwick 2008, Schrappe und Pfaff 2017 S. 24f). Diese Klassifizierung hat zahlreiche Implikationen:
- die Einführung von P4P ist keine lineare Intervention wie die Gabe eines Medikamentes, sondern ist aus zahlreichen
Einzelinterventionen zusammengesetzt (z.B. Gesetzgebungsverfahren, öffentliche Diskussion, Umsetzungsregelungen, lokale
Verhandlungen (wie im Gesetz auch vorgesehen), organisatorische Umsetzung, juristische Aufarbeitung etc.),
- das Zusammenwirken der Einzelinterventionen ist komplex, d.h. in seiner Wirkung nicht vorhersehbar, wenngleich anhand
von Erfahrungswerten bestimmte Tendenzen abschätzbar erscheinen (die Komplexitätstheorie spricht von Attraktoren),
- die Intervention ist extrem Kontext-sensibel, reagiert also sehr intensiv auf Umgebungsbedingungen (z.B. das dominierende
Vergütungssystem wie - in unserem Fall - das DRG-System, dessen unerwünschte Effekt u.U. verstärkt werden),
- die Gesamtwirkung mehrerer nebeneinander bestehenden CMCI’s (also aktuell z.B. Public Reporting, Qualitäts-orientierte
Planungsansätze, Selektivverträge mit Qualitätselementen (”Qualitätsverträge” nach §110a SGB V) übersteigt regelhaft die
Summe der Einzelwirkungen.
Ähnlich wie in der Krankenhaushygiene oder im Straßenverkehr, wo
solche gebündelten Interventionen an der Tagesordnung sind, führt dies
zur paradox erscheinenden Situation, dass sich die Gesamtintervention zwar
als sehr wirkungsvoll darstellt (z.B. Abnahme der Straßenverkehrstoten in den
letzten 40 Jahren), die Einzelinterventionen aber im Rahmen dieser komplexen
Gesamtsituation keinen isoliert nachweisbaren Effekt mehr haben (sondern nur
im Kontext der Gesamtintervention wirksam sind). Dies soll nicht heißen, dass
man die Gurtpflicht aufheben sollte, aber es ist wahrscheinlich, dass man heute
in einem “kontrollierten Versuch” (den niemand durchführen wird) keine isolierte
Wirkung dieser Einzelmaßnahme mehr feststellen kann (allerdings, um das
Mode-Wort zu nutzen, wird die Resilienz (Elastizität) des Systems geschwächt
werden). Man muss sich also analog der Problematik stellen, dass P4P
durchaus wirksam sein kann, die Wirkung in einer relevanten Größenordnung
(!) aber nur im Kontext anderer, in die gleiche Richtung weisenden
Interventionen auftritt. Mit anderen Worten: P4P allein, da sind nur kleine
Effekte zu erwarten, aber im Kontext sinnvoll angeordneter anderweitiger Interventionen ist durchaus ein kräftiger Effekt denkbar,
und die Belastbarkeit des Systems wird gestärkt. Wie kommt man zu der Entscheidung, darauf zu setzen? Nun, das ist das
politische Risiko, ohne Risiko kein Fortschritt. Und wenn die unerwünschten Effekte überwiegen (die wissenschaftlichen Befunde
sprechen nicht diese Sprache), muss man es wieder abschaffen.
Unter der Perspektive der Multikomponenten-Interventionen (CMCI) sind im gegenwärtigen deutschen Gesundheitssystem
tatsächlich zahrleiche Initiativen und Tendenzen zu erkennen, die die Qualität (und Sicherheit) der Versorgung verbessern
sollen und im positiven Fall “an einem Strick ziehen”. Diese Initiativen reichen vom Qualitätsbericht über Bestrebungen zur
Stärkung der Patientenorientierung bis zum Innovationsfonds (s. Abb. 3). Ohne zu behaupten, dass sie bereits zu einer
Verbesserung geführt haben oder dass sie derzeit bereits sinnvoll angeordnet wären (dieses würde nämlich ein weiteres wichtiges
fehlendes Element voraussetzen: einen Rahmenplan, der übergeordnete Ziele definiert und aktuell nachgehalten wird (s. Quelle, s.
auch Schrappe 2014 S. 287ff)), ist nicht zu verkennen, dass der Gesetzgeber hier zumindest bereit war, eine breiter angelegte
politische Absicht zu formulieren (s. Abb. 3). Zu einem adäquaten Rahmenplan würde allerdings auch eine strukturelle
Gesamtweiterentwicklung des derzeitigen, in seiner sektoralen Blockade verharrenden Gesundheitssystems gehören, denn man
muss immer wieder wiederholen: qualitätsverbessernde Maßnahmen können nicht die Weiterentwicklung der
Grundstrukturen ersetzen, sondern können diese Entwicklungen nur fördernd begleiten.
Es geht also weniger um die Frage: bewirkt P4P wirklich eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung (oder nicht), sondern
um die Frage: unter welchen Kontextbedingungen und unter welchen Umsetzungsmodalitäten ist eine Wirkung zu
erwarten, was können die negativen (unbeabsichtigten) Effekte sein, und welche Wechselwirkungen mit anderen
Interventionen sind zu erwarten.
Die Konsequenzen für die Einführung von P4P bzw. der Qualitäts-abhängigen Vergütung sind an anderer Stelle ausführlich
dargestellt (s. These 3 in der Eröffnungs der Podiumsdiskussion zu Beginn des 10. Nationalen Qualitätskongresses 2016).
Insbesondere dürfen keine technisch-methodische Fehler bei der Einführung gemacht werden (s. These 4). Die wichtigsten sechs
Problemfelder seien daher hier nochmals genannt:
1. Valide Indikatoren statt quantitativer Erhebung: Qualitätsindikatoren sagen Defizite voraus und sind daher Problem-orientiert
einzusetzen. In Deutschland werden jedoch Ereignisse vielfach quantitativ erhoben, ohne dass der Bezug auf Qualitätsprobleme
geklärt ist (klassisches Beispiel Mortalität, ein schlechter Qualitätsindikator, der unabhängig von der jeweiligen Risikoadjustierung
maßgeblich von dritten Faktoren bestimmt wird). Diese zunächst belanglos erscheinende Unterscheidung ist für die Wirksamkeit
von Qualitätsverbesserungsmaßnahmen von nicht zu unterschätzender Bedeutung, denn die quantitative Erfassung macht eine
vorherige Problemanalyse entbehrlich. Außerdem sind die statistischen Anforderungen unterschiedlich, da sich die Validität von
Indikatoren auf eine hohe Sensitivität bezieht (unter Inkaufnahme geringerer Spezifität), im Gegensatz zu quantitativen Methoden
mit gleichrangigen Anforderungen an Sensitivität und Spezifität. Ein sensitiver Indikator wird folglich immer auch einige solcher
Einrichtungen als „auffällig“ identifiziert, die gar kein Qualitätsproblem haben (sog. „intrinsische Ungerechtigkeit“). Für Ärzte sind
Indikatoren oft noch aus einem anderen Grund schwer verständlich, weil das Indikatorenkonzept ihrem Verständnis klinischer
diagnostischer Verfahren (zu denen Indikatoren nicht gehören) zuwiderläuft, bei denen die falsch-positiven Ergebnisse (Spezifität
bzw. PPW) im Vordergrund stehen.
2. Ergebnis-Indikatoren zugunsten valider Prozessindikatoren zurückstellen: Obwohl Ergebnisindikatoren durch den Anschein
gestützt und im SGB V genannt werden, sind sie von einer Reihe maßgeblicher Nachteile begleitet:
- sie betreffen bereits eingetretene Ereignisse, während Prozessindikatoren Ereignisse vorhersagen (bad apple-Problematik),
- sie müssen im Ggs. zu den meisten Prozessindikatoren risikoadjustiert werden,
- im Ggs. zu Prozessindikatoren ist die Verantwortlichkeit oft nicht klar (z.B. nach Entlassung aus der stationären Behandlung),
- kleine Einrichtungen werden aus statistischen Gründen benachteiligt (höhere Häufigkeit von „Ausreißern“, Einzelereignisse
sind nicht zu neutralisieren),
- wenig motivierend wegen der bad apple-Problematik, während Prozessindikatoren ein präventives Eingreifen möglich
machen, und vor allem
- ist ihnen ein Mengenanreiz immanent, was besonders bei P4P-Programmen eine wichtige Rolle spielt (Attraktion leichter
Fälle bei mengenmäßig "ausbaubaren" Leistungen, die Ergebnisqualität steigt, Risikoadjustierungsmodelle sind leicht zu
beeinflussen).
Bei Prozessindikatoren sind jedoch ebenfalls zwei Aspekte zu berücksichtigen:
- sie sind nicht so stark mit den Ergebnissen korreliert, wie man es gerade bei stark EBM-abgesicherten Parametern meinen
sollte. Es ist zwar durchaus ein (hoch-signifikanter) Effekt von Prozessindikatoren auf Outcomes nachweisbar, wie man z.B.
bei immerhin 3657 Krankenhäusern in den USA anhand der Daten aus dem Hospital Compare Programm nachweisen
konnten (Werner und Bradlow 2006), aber quantitativ enttäuschen die Ergebnisse dennoch. Die zu ihrer Evaluation
verwendeten Studiendesigns, die den komplexen Bedingungen, in denen solche Prozessparamater wirken, nicht gerecht
werden, stehen als Ursache in der Diskussion.
- ganz entgegen dem Augenschein sind insbesondere solche Prozessindikatoren, die nicht durch EBM bzw. Leitlinien
abgesichert sind, bei denen also der Informationsvorsprung der „Experten vor Ort“ noch besteht, besonders wirksam, während
bekannt EBM-abgesicherte Prozessindikatoren z.B. in P4P-Programmen keinen Effekt zeigen. Dieser irritierende Befund lässt
sich aus der Principal Agent Theorie erklären. Bei Indikatoren, bei denen die Informationsasymmetrie aufgehoben ist, ist eine
Einzelfallvergütung sehr viel effektiver.
Diese Gesichtspunkte sollen jedoch nicht davon ablenken, dass die international führenden, umfassenden Projekte zur
Qualitätsverbesserung fast ausnahmslos Prozessindikatoren einsetzen (auch wenn schrittweise sog. Outcome-Indikatoren, also
Prozessindikatoren mit starker Ergebnisrelevanz (z.B. Komplikationsraten) einbezogen werden). Zu beachten ist, dass der
engllisch-sprachige Begriff der Outcome-Indikatoren NICHT mit dem deutschen Begriff der Ergebnis-Indikatoren nach Donabedian
identisch ist (z.B. sind Komplikationen streng genommen Prozessparameter, werden aber z.B. in den USA als Outcome-Indikatoren
angesehen).
3. Vorsicht mit Strukturindikatoren im Zusammenhang mit der Krankenhausplanung - die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass
Träger von Krankenhäusern eher in Strukturveränderungen investieren als eine Schließung in Betracht zu ziehen. Im
Zusammenhang mit P4P wirken Strukturindikatoren als Investitionsbeihilfen, so dass es mittelfristig noch schwieriger wird, das
Krankenhaus in eine integrierte Versorgungseinheit zu überführen („wir haben doch gerade eben die Intensivstation neu gebaut“).
4. Routine-Daten sind schlecht geeignet, insbesondere wegen ihres Sensitivitätsproblems, da sie in erster Linie die Vergütungs-
bezogene Dokumentation widerspiegeln. Die Sensitivitäts-Problematik wird durch die jetzt auf Routinedaten umgestellte Erhebung
des Dekubitus unterstrichen (ältere Patienten: Underreporting - keine Vergütungsrelevanz; jüngere Patienten: sehr hohe Raten -
hohe Vergütungsrelevanz). Weitergehend sind jedoch folgende Aspekte zu beachten:
- Routinedaten sind (ebenso wie das DRG-System sui generis) Prozeduren-lastig, sie fördern also die operativ-
akutmedizinische Ausrichtung des Systems,
- sie bilden trotz aller „transsektoralen“ Versuche in erster Linie die sektorale Logik der Vergütungssysteme ab und fördern
nicht die Integration,
- sie verstärken den Mengenanreiz des Systems (statt der Prävention),
- sie präjudizieren den Gebrauch von Ergebnis-Indikatoren (mit wiederum Routinedaten-gestützter Risikoadjustierung), und
- sie stärken den Anbieterbezug (da diese die Vergütung auslösen) und nicht den Patientenbezug.
Routinedaten behindern also die notwendige Neuausrichtung des System und stabilisieren die derzeitige akutmedizinisch-
prozedurale Ausrichtung. Es gibt jedoch auch Indikatoren, die sehr gut mit Routinedaten zu erheben sind (z.B. Mindestmengen –
aber auch hier: Gefahr der Mengenausweitung).
Mit Nachdruck ist darauf hinzuweisen, dass es seit über vierzig Jahren ein prominentes Beispiel gibt, bei dem man mit klinisch-
epidemiologischen Falldefinitionen zu stabilen, international vergleichbaren Zahlen kommt: die Infektionsepidemiologie mit ihren
Falldefinitionen der Centers of Disease Control (CDC). Die Erarbeitung von klinisch-epidemiologischen Falldefinitionen für die
allgemeine Qualitätsicherung sollte mit hoher Priorität auch außerhalb der Infektionsepidemiologie vorangetrieben werden.
5. Patienten-Reported Outcome Measures müssen in den Vordergrund gerückt werden, dazu gehören alle Dinge, die der Patient
selbst und nur selbst berichten kann (z.B. postoperative Schmerztherapie). Sie betreffen vornehmlich den Bereich der
Prozessindikatoren (Koordination, Information, Kommunikation). Diese "PROMS" stellen einen wichtiger Einstieg in das Thema
unterschiedlicher Qualitätsperspektiven dar und sind international bereits im Zusammenhang mit P4P-Programmen in Gebrauch.
Entsprechende Entwicklungen durch das IQTiG nach den Bestimmungen des §137 sind daher von großer Wichtigkeit.
6. Vorsicht mit dem Begriff der Exzellenz-Indikatoren (z.B. Eckpunkte-Papier der Bund-Länder-Kommission zur
Krankenhausreform („außerordentlich gute Qualität“)): Abgesehen von der sozialrechtlichen Wertung – im SGB V (z.B. §12) werden
die Beriffe „ausreichend“,, „zweckmäßig“, „wirtschaftlich“ und „notwendig“ verwendet – werden Indikatoren auch international immer
zur Vorhersage negativer Entwicklungen verwendet. Hinzu kommen statistische Feinheiten: ein Qualitätsindikator darf kein
Qualitätsproblem übersehen, er ist folglich hoch-sensitiv eingestellt, ein sog. „Exzellenz-Indikator“ müsste aber hoch-spezifisch
eingestellt werden, um denjenigen ohne „Exzellenz-Qualität“ auszuschließen. Dies würde ein Verkehrung des Indikator-Begriffs in
sein Gegenteil bedeuten.
Abschließend bleibt nur zu konstatieren, dass bislang ein Conceptual Framework (Rahmenkonzept) fehlt, das politisch die
Richtung vorgibt; Qualität kann politische Entscheidungen nicht ersetzen. Ein solches Rahmenkonzept sollte den
beteiligten Akteuren als Orientierung für ihr Handeln und ihre Koordinierungsanstrengungen dienen (analog Crossing the Quality
Chasm des IOM 2001). So hat Neuseeland P4P-Elemente in sein “Integrated Peformance and Incentive Framework” integriert, das
Interventionen auf der System-, der Organisations- und der lokalen Ebene kombiniert (die Ebenen der Patienten und der
Profesionen wären noch zu ergänzen) (Ashton 2015). Qualität kann eine politisch gewollte strukturelle Weiterentwicklung (in erster
Linie Koordination und Integration der Versorgung) also sehr intensiv unterstützen, aber Vorsicht: Qualität kann die politische
Richtungsgebung nicht ersetzen.
Angesichts der Tatsache, dass es sich bei P4P um den Einsatz eines hochkomplexen Instrumentes in einem hochkomplexen
System handelt (die sog. „doppelte Komplexität“ des Gesundheitssystems), darf es nicht verwundern, dass es des Rückgriffs auf
ein hinterlegtes Rahmenkonzept bedarf, denn nur so ist es z.B. möglich, Fehler bei Einführung und Konzeption sowie die
Formulierung nicht erfüllbarer Erwartungen zu vermeiden. Ein solches Rahmenkonzept muss den Kontext beschreiben, die
Auswirkungen antizipieren und den Hintergrund für Evaluationsmaßnahmen bilden; es sollte dementsprechend folgende Aspekte
umfassen:
- Organisation und Autonomie mit Schwerpunkt Expertenorganisation (professional bureaucracy) zur Beschreibung der
Umsetzungsoptionen auf der Ebene der Institutionen,
- Komplexität des Systems mit der Identifikation der wichtigsten Handlungsfelder,
- Strategien der Verhaltensänderung mit Reflexion von Professionalismus und seiner Alternativen, um glaubwürdige
Verbesserungsansätze darstellen zu können
- ökonomische Grundannahmen insbesondere zur Bedeutung von Informationsasymmetrie und zur Rolle
verhaltensökonomischer Ansatzpunkte,
- Wechselwirkung mit den dominierenden Vergütungslogiken, und
- politikwissenschaftliche Konzepte zur Umsetzung.
(Weitere Ausführung s. hier unter These 5)
Literatur
Ashton, T. (2015): Measuring Health System Performance: A New Approach to Accountability and Quality Improvement in New Zealand. Health Pol.
119, 999-1004
Berwick, D.M. (2008): The Science of Improvement. JAMA 299, 1182-84
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) (2016): Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern / QSKH-RL vom 21.7.2016,
BAnz AT 25.10.2016, in Kraft seit 1.1.2017
Institute of Medicine (2001): Crossing the Quality Chasm: A New Health System for 21th Century. National Academy Press, Washington
Kondo, K. (2015), Damberg, C., Mendelson, A., Motu’apuaka, M., Freeman, M., O’Neil, M., Relevo, R., Kansagara, D.: Understanding the
intervention and implementation factors associated with benefits and harms of pay for performance programs in healthcare. VA-ESP Project #05-225
Mendelson, A. (2017), Kondo, K., Damber, C., Low, A., Motu’apuaka, B., Freeman, M., O’Neill, M., Relevo, R., Kansagara, D.: The Effects of Pay-for-
Performance Programs on Health, Health Care Use, and Processes of Care. A Systematic Review. Ann. Intern. Med. 166, 341-53
Milstein, R., Schreyögg, J. (2016): Pay for Performance in the Inpatient Sector. A Review of 34 P4P Programm in 14 OECD Countries. Health Pol.
120, 2016, 1125-40
Ogundeji, Y.K. (2016), Bland, J.M., Sheldon, T.A.: The Effectiveness of Payment for Performance in Health Care: A Meta-Analysis and Exploration of
Variation in Outcomes. Health Pol. 120, 1141-50
Sachverständigenrat (1997) für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, Henke, K.-D., van Eimeren, W., Franke, A., Neubauer, G., Scriba,
P.C., Schwartz, F.W., Wille, E.: Gesundheitswesen in Deutschland. Kostenfaktor und Zukunftsbranche. Kurzfassung, Nomos 1998
Sachverständigenrat (2007) für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen: Kooperation und Verantwortung. Voraussetzungen für eine
zielorientierte Gesundheitspolitik. Gutachten 2007, Band I und II, Nomos, Baden-Baden 2008
Schrappe, M. (2014): Qualität 2030 – die umfassende Strategie für das Gesundheitswesen. Mit einem Geleitwort von Ulf Fink und Franz Dormann.
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin
Schrappe, M., Pfaff, H. (2017): Einführung in die Versorgungsforschung. In: H. Pfaff, G. Glaeske, E. Neugebauer, M. Schrappe (eds.): Lehrbuch
Versorgungsforschung, 2. vollst. überarb. Auflage. Schattauer Verlag, Stuttgart 2017, 1-68
Veit, C., Hertle, D., Bungard, S., Trümner, A., Ganske, V., Meyer-Hofmann, B.: Pay-for-Performance im Gesundheitswesen: Sachstandsbericht zu
Evidenz und Realisierung sowie Darlegung der Grundlagen für eine künftige Weiterentwicklung. Ein Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums
für Gesundheit, 2012
Werner, R.M. (2006): Bradlow ET: Relationship Between Hospital Compare Performance Measures and Mortality Rates. JAMA 296, 2694-2702

22

Seite



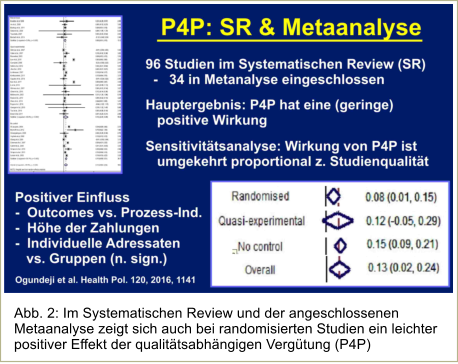

Abb. 3: Breite des gesetzgeberischen Impulses: P4P
steht im Kontext zahlreicher Gesetzesvorschriften, die
die Thematik Qualität der Gesundheitsversorgung
adressieren



22

Seite
